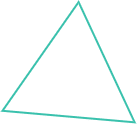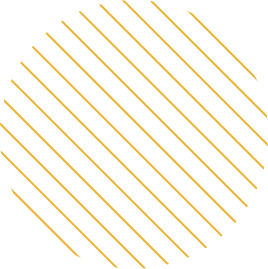Am Morgen des 10.08.2023 stand ich also mit meiner Familie am Berliner Flughafen und suchte den Lufthansa Gepäckschalter. Mein Koffer erschien mir auf dem Rollband, dafür dass mir der Inhalt für ein ganzes Jahr reichen musste, auf einmal ziemlich klein. Mit einem Ruck setzte sich das Band in Gang und verschlang mitsamt dem Gepäck auch das Gefühl mich nochmal umentscheiden zu können. In kürzester Zeit werde ich in ein ganz neues Leben katapultiert.
Nur 12 Stunden Flug und eine wilde Autofahrt durch Costa Ricas dunklen, kurvigen und viel zu schmalen Straßen später, war ich umgeben von runden Türknäufen und Fenstern, die ich nicht verstand zu öffnen. Noch weniger konnte ich mich allerdings an den leinwandgleichen Ausblick hinter ihnen gewöhnen. Die tiefgrünen bewaldeten Berge wirkten trotz der zahlreichen mir noch unbekannten Tiere, die darin wohnten, friedlich.
Die unberührte Natur rund um die Visioneers Finca, in der wir mit den anderen Freiwilligen zusammen einen einwöchigen Sprachkurs absolvierten, bildete das exakte Gegenteil zu San Josés dreckigen, lauten und überfüllten Straßen, die ich jetzt mein Zuhause nenne. Fragt man Einheimische nach ihrer Meinung über die eigene Hauptstadt, fällt immer das gleiche Wort: “feo” (=hässlich). Und obwohl die kleinen bunten Häuser, die Strommasten und die Palmen für Ausländer wie mich ästhetisch wirken, weiß ich was die Ticos meinen. Die Straßen haben Schlaglöcher, von den Überirdischen Leitungen hängen lose Kabel, wenn in leeren Hauseingängen kein Müll liegt, dann liegt an seiner Stelle dort meist ein Obdachloser oder gleich eine ganze Familie.
Wenn ich mal alleine durch eine dieser Straßen laufe, habe ich immer das Gefühl beobachtet zu werden. Meistens sind es Männer, die mir beim Vorbeigehen oder aus ihren Autofenstern hinterherstarren und meine grünen Augen oder meine blonden Haare inspizieren, als wäre ich hinter einem Fensterglas im Zoo. Nur das man im Zoo die Tiere meistens nicht nach ihrer Telefonnummer fragt. Auch auf meinem Arbeitsweg ist das nicht anders. Dass ich als Frau in diesem Land eine andere Rolle trage, fällt mir immer wieder spätestens dann auf, wenn mir auf dem Weg über eine schmale Brücke Männer den Vortritt gewähren, obwohl genug Platz für zwei aneinander vorbeilaufende Personen wäre.
Im Projekt angekommen betätige ich die Klingel des zweifach umzäunten Hauses mit gemischten Gefühlen. Zum einen bin ich froh, dass mir auf meinem 15-minütigen Fußweg nichts passiert ist und ich über die Türschwelle in Sicherheit vor Taschendiebstählen oder Überfällen treten kann, zum anderen zögere ich, weil ich weiß, dass ich ab dem Betreten des Heims, bis zum Verlassen keine ruhige Minute mehr haben werde. Jeden Morgen von Montag bis Freitag fällt dann schließlich um 7.30 Uhr die Tür hinter mir ins Schloss und ich werde mit 19 hellen Kinderschreien begrüßt. Erst nachdem ich mir die Hände gewaschen habe, obwohl ich aus dem Heim meistens mehr Keime mitnehme, als ich reinbringe und deshalb alle zwei Wochen mit Kinderkrankheiten zu Hause bleiben muss, geht die Arbeit richtig für mich los. Dann heißt es unter lautem Protest Zähneputzen und keine Kinder meiner Gruppe auf dem Weg in ihren Raum zu verlieren. Nur zwei Stunden nach dem Frühstück, bekommen die Kinder ihre nächste Mahlzeit, die “Merienda”. Ein Snack, der meistens aus Keksen und gezuckertem Fruchtsaft besteht. Manchmal frage ich mich, ob ich die Kinder wohl jemals Wasser hab trinken sehen. Denn der beliebten “Fresco” gehört dazu, wie die Gebete vor jedem Essen. Es gibt ihn auch zum Mittagessen und zur Nachmittags Merienda nach dem Mittgasschlaf. Die Kinder schlafen zwischen ein und zwei Stunden, in denen ich Pause habe und den restlichen Reis mit Bohnen essen darf. Auch wenn ich davon nicht wirklich satt werde, nehme ich mir nicht nach, sondern setzte mich nach draußen in den nicht-überdachten Teil des Außenbereiches, um Sonne zu tanken, die durch den Stacheldraht auf mich herabscheint.
Die letzten zwei Stunden Arbeit vergehen dann meistens viel schneller als der Vormittag und wenn ich um 15.30 Uhr die Kinder umarme und Küsschen verteile, fällt mir der Abschied nach dem harten Tag trotzdem schwer. Wie alle anderen Mitarbeiterinnen werde ich von den Kindern Tia (=Tante) genannt und nach fast drei Monaten fühle ich mich auch wie ein festes Mitglied in der Großfamilie des Heims. Ich entwickle eine Bindung zu den Kindern, die mit viel Liebe und Verantwortungsgefühl einhergeht und jeden noch so anstrengenden Arbeitstag zu einer Bereicherung macht. Seit meinem Spanisch sich deutlich verbessert hat, auch eine Bindung zu den anderen Tias, die mir das Gefühl geben, wirklich gebraucht zu werden. Sofern ich nicht verabredet bin, bestehen meine Nachmittage dann meistens daraus, auf einen Bus zu warten, der mich ins Zentrum bringt. Obwohl es weder Haltestellen noch feste Routen, geschweige denn Zeitpläne gibt, bin ich mittlerweile ziemlich gut darin geworden mich nicht jedes Mal zu verfahren und nur noch gelegentlich zu spät zu kommen. Anfangs hatte ich versucht meine Gastfamilie bezüglich der Busse um Hilfe zu bitten, aber da die meisten Ticos immer das Auto nehmen, wussten auch sie nicht weiter. Dass zum Beispiel die Anzeige “San Jose” auf den Bussen nicht bedeutet, dass sie generell durch die Stadt fahren, sondern in das zentral gelegene gleichnamige Viertel “San Jose” habe ich mir nach und nach selbst beigebracht. Endlich im Zentrum angekommen, gibt es eigentlich immer etwas zu tun. Man kann shoppen, in Cafés und Restaurants gehen oder sich in einen Park setzten. Es sei denn, man möchte gleichaltrige Ticos kennenlernen, die habe ich bis jetzt nur in Kirchengruppen getroffen, da die Religion hier für alle Menschen eine sehr wichtige Rolle spielt. Meistens bin ich jedoch damit beschäftigt, meine Jackentaschen nach meinen Wertsachen zu kontrollieren. Mein Handy hole ich nur raus, um auf Google Maps sicherzugehen, dass ich mich nicht verlaufe oder nach der Uhrzeit zu schauen, damit ich einschätzen kann, wann ich mich auf den Heimweg machen muss, um noch vor der Dunkelheit anzukommen. Wenn ich gegen sechs zu Hause bin, führe ich meistens Smalltalk mit meiner Gastfamilie, der sich immer noch ein bisschen steif und gezwungen anfühlt und ab und zu noch an meinem Spanisch hapert, bis es Abendessen gibt, bei dem meine Gastmutter darauf achtet, einen Mix aus typisch costa-ricanischen und europäischen Gerichten zu kochen.
Am nächsten Morgen weckt mich dann um 6:30 Uhr die Sonne, die durch mein Milchglas Oberlicht scheint und der Tagesablauf beginnt von vorne. Nach dem Frühstück verlasse ich das Haus durch das große vergitterte Tor, das ich immer zweimal abschließen muss und höre noch, wie sich mein Gastvater mir die Gruß- und Abschiedsformel “Pura Vida” hinterherruft und ich muss lächeln. Das costa-ricanische Lebensmotto, das ein fröhliches und optimistisches Lebensgefühl beschreibt, das die Ticos, auch dann an den Tag legen, wenn die Umstände von außen betrachtet nicht wirklich perfekt sind. Es geht darum sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, die schönen Dinge des Lebens zu genießen, andere so zu nehmen, wie sie sind und glücklich zu sein.
Willst du auch einen Freiwilligendienst in Costa Rica machen? Dann bewirb dich hier!