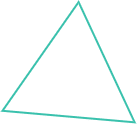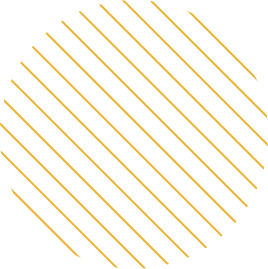Hallo zusammen, ich bin Hanna, 20 Jahre alt, und seit zwei Monaten in Peru bei Atiycuy für meinen Freiwilligendienst.
Es gibt viele Blogbeiträge, die die Arbeit bei Atiycuy gut zusammenfassen und interessante Einblicke geben. Nach zwei Monaten könnte ich es wohl kaum besser machen, also werde ich mich (heute zumindest) nicht darauf konzentrieren. Stattdessen möchte ich etwas allgemeiner über meine ersten zwei Monate sprechen – über das Thema Komfortzone und Diskomfort in meinem Freiwilligendienst.
Die Komfortzone
Ein Thema, das wohl fast Hand in Hand mit einem Freiwilligendienst geht, ist die Komfortzone. „Raus aus der Komfortzone und rein ins Abenteuer!“, „Aus der Komfortzone ausbrechen“ oder „Lernen außerhalb der Komfortzone“. Vielleicht hast du solche Sätze auch schon auf Websites für FSJ-Programme gelesen, oder du erkennst diese Formulierungen aus Bewerbungsschreiben wieder: „Ein Freiwilligendienst ermöglicht es mir, meine Komfortzone zu verlassen und neue Herausforderungen anzunehmen, die mich persönlich und beruflich wachsen lassen.“ Vielleicht hast du sowas sogar selbst in deiner Bewerbung gesagt – ich auf jeden Fall. Das ist alles andere als verwerflich, denn die Erweiterung der Komfortzone ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt eines FSJs. Und so habe ich mich in den letzten zwei Monaten auch (halbwegs freiwillig) viel mit meiner eigenen Komfortzone auseinandergesetzt.
Während meines FSJs hat sich alles geändert, was mir zuvor Komfort gegeben hat: die Sprache, die Menschen, meine Routine, der Ort, den ich Zuhause nenne. Statt Brot gibt es hier Reis und statt Indie-Musik läuft im Radio ständig spanische Salsa-Musik. Statt Picknicks oder Chai Latte mit meinen Freundinnen zu trinken, schwimme ich in Flüssen im peruanischen Regenwald. Vintage-Röcke habe ich gegen Wander-„Zipp-Hosen“ getauscht. Die Hunde bellen überall, das Müllauto fährt mit Musik durch die Straße, und an die Frau, die jeden Samstagmorgen laut „TAMALES“ schreit, habe ich mich auch schon gewöhnt. Der Mond ist verkehrt, um 18 Uhr ist es stockdunkel, und das Klopapier kommt nicht ins Klo, sondern in den Mülleimer daneben. Kurz gesagt: Alles ist anders.




Alles ist anders
Und das ist genauso aufregend wie anstrengend. Zumindest für mich war und ist es immer noch manchmal herausfordernd, ständig mit Neuem konfrontiert zu werden, ohne in meine gewohnte Komfortzone flüchten zu können. Aber ich stimme den Pinterest-Zitaten zu: Nur außerhalb der Komfortzone kann man über sich hinauswachsen. Trotzdem gibt es Momente, in denen es schön und wichtig ist, sich dort hin zurückzuziehen. Also mache ich einfach so viel wie möglich hier zu meiner Komfortzone. Ich lerne (halbwegs) fleißig Spanisch, damit ich diese Sprache auch zu meinem Komfort machen kann. Ich bemühe mich, neue Leute kennenzulernen, aber gleichzeitig telefoniere ich auch mal nach Hause. Niemand hier kann meine beste Freundin oder meine Mutter ersetzen, und das muss auch niemand, weil es ja zum Glück das Internet gibt. Das Aufbauen neuer Routinen (zum Beispiel morgens Yoga zu machen) hilft mir genauso wie das Beibehalten alter Routinen (abends zu leicht cringenden YA-Fantasy-Hörspielen einzuschlafen). Und manchmal reicht es schon, das Stück deutsche Schokolade zu genießen, das ich eigentlich als Gastgeschenk mitgebracht habe, um ein bisschen Heimat zu spüren. Manchmal muss es dann aber doch das selbstgemachte deutsche Brot sein. Und manchmal reicht es auch einfach, der spanischen Salsa zu entkommen, um mir Musik von Chappell Roan anzuhören.
Ich mache das hier immer mehr zu meinem Zuhause, auch wenn das vielleicht länger dauert, als ich gedacht hätte. Aber mit jeder Pflanze, die ich adoptiere, jedem Traumfänger und jedem Bild, das ich in meinem Zimmer aufhänge, fühlt es sich mehr nach meinem Raum an.
All das gibt mir Komfort und Kraft, meine Komfortzone dann auch wieder zu verlassen und dem ständig Neuen mit Neugier zu begegnen. Das war wahrscheinlich das, was meine ersten Monate hier am meisten geprägt hat: herauszufinden, was alles in meiner Komfortzone liegt und was nicht – und wie ich damit am besten umgehe. Es hat mir unglaublich viel über mich selbst gezeigt, und ich freue mich darauf, noch viele weitere Monate damit zu verbringen, sowohl mich selbst als auch dieses vielfältige Land besser kennenzulernen.
Und natürlich freue ich mich darauf, euch weiterhin darüber zu berichten. Bis zum nächsten Mal! 🙂